|
|
|||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||
 |
|||
|
Predigt des damaligen Bischofs von Eichstätt Dr. Karl Braun zum Blutfreitag 1986 in Weingarten 8. Mai 1986 Wir empfehlen diese Predigt allen wärmstens zur Lektüre - auch wenn sie vielleicht etwas lang ist. Sie gibt jede Erklärung, die wir für das Verständnis der Ewigen Anbetung brauchen. Ob es Ihnen wohl auch so ergeht, wie mir, wenn ich in der Offenbarung des Evangelisten Johannes lese und die überwältigende Schau der himmlischen Liturgie auf mich wirken lasse: sie ergreift mich stets aufs neue. Der Lieblingsjünger des Herrn, der heilige Johannes, berichtet, wie er auf einem Thron im Himmel den lebendigen Gott sieht. Rings um ihn die Schar der Engel und Heiligen, die vierundzwanzig Altesten und die vier Wesen. Tag und Nacht ruhen sie nicht, Gott zu lobsingen: “Heilig Herr, Gott, Herrscher des Alls!” Zwischen dem Thron Gottes und den Scharen der Engel und Heiligen erblickt Johannes ein Lamm, es ist der geopferte Gottessohn Jesus Christus. Ihm singen die himmlischen Scharen: “Du wurdest geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erworben aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Nationen und Völkern, und du hast sie für unsern Gott zu Königen und Priestern gemacht ... Und alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und auf dem Meer, alles, was in der Welt ist, hörte ich sprechen: Ihm, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm gebühren Lob und Ehre und Herrlichkeit und Kraft in alle Ewigkeit ... Und die vierundzwanzig Altesten fielen nieder und beteten an” (Offb 5, 11 4) . Anbetung Gottes ist das Ziel der gesamten Schöpfung und der Weltgeschichte. Anbetung Gottes: ist sie vielen nicht fremd geworden? “Anbetung”, in einer Zeit, die, mehr denn je, säkularisiert, diesseitsgerichtet ist? In kurzsichtigem Vertrauen auf Wissenschaft, technischen Fortschritt und materielle Güter baut der moderne Mensch eine “Stadt ohne Gott” (H. Knox). Er fragt nach dem Machbaren und Irdischen, aber kaum nach dem, was von oben kommt. Er huldigt letztlich dem Grundsatz des Materialismus: “Begnüge dich mit dieser sichtbaren Welt. Sie ist die einzige Wirklichkeit. Hier findest du deine Erfüllung. Alles andere ist Illusion, ‘Pfaffengeschwätz’, Opium für das Volk, Mythos.” Aber dieser Materialismus, östlicher wie westlicher Prägung, ist - wir erfahren es doch Tag für Tag neu - zu einem Nährboden für Gewalt und Terror, Ungerechtigkeit und Unmenschlichkeit, egoistisches Profitstreben und jegliche Form von Perversität geworden. In zunehmendem Maß erlebt so der Mensch des ausgehenden 20. Jahrhunderts die unheimlichen Folgen materialistischer Überheblichkeit. Für eine Generation, die das Glück aus eigener Macht erzwingen will, ist die Stunde der Wahrheit und der Entscheidung gekommen. Wir stehen am Scheideweg zwischen dem kläglichen Angebot es Materiellen, des rein Irdischen und Vergänglichen, und der Verheißung des Geistes Gottes. Manches deutet daraufhin, dass die weltanschauliche Großwetterlage umzuschlagen beginnt. Viele werden nachdenklich. Gerade junge Menschen sind von unserer permissiven und konsumorientierten Gesellschaft enttäuscht. Sie suchen nach dem ganz Anderen, sie sind offen für das Größere, für die Dimension des Transzendentalen. Sie erahnen, dass es mehr gibt als den begrenzten Horizont unserer Welt, sie wünschen, daß das Leben getragen sei von der Erfahrung einer größeren Wirklichkeit. Sie erkennen: Ich darf nicht einfach nur vegetieren wie der Vogel im Käfig, der Hund im Hof oder die Kuh auf der Wiese. Ich kann nicht nur schuften und schaffen, damit ich immer mehr Reichtum ansammle, um den sich nach wenigen Jahren die Erben zerstreiten. Ich darf nicht an einem Genuss zum anderen taumeln, um am Ende unerfüllt dazustehen. Ich erkenne, dass ich nicht ein Maulwurf bin, der sich ein Leben lang durch die dunklen Gänge des Alltags gräbt, ein Maulwurf, der sich nur von den Kümmerlichkeiten drunten in der schweren Erde nährt, ein Maulwurf, der für ein paar Augenblicke aufsteigt an das Licht und an die Sonne, dann aber schnell verschwindet und weiterfährt in seinem gewohnten “Maulwurfsdasein”. Und dieses “Maulwurfsdasein”, nämlich die materialistische Versklavung unserer Zeit wird nicht durch Politik, Wissenschaft und Technik überwunden - diese sind zwar Mittel zur Daseinsbewältigung, aber sie bleiben begrenzt auf das Innerweltliche. Der einzige Ausweg besteht darin, die geistige Seite unserer Existenz ernstzunehmen, die alles Materielle übersteigende Wirklichkeit: die Wirklichkeit Gottes, dem wir Anbetung schulden. Liebe Zuhörer, auch der vermeintlich so “aufgeklärte” Mensch von heute betet etwas an. Er geht nicht vor Gott in die Knie, sondern vor Schein- und Ersatzwerten. Der Materialismus unserer Tage hat die Anbetung nicht aufgehoben, er hat sie nur verschoben - vom Schöpfer weg, hin zum Geschöpf, zum Geschaffenen, zum Werk des Menschen. Doch wie gefährdet alles Menschenwerk ist, hat uns dies nicht in erschreckender Weise der Reaktorunfall von Tschernobyl vor Augen geführt? Müsste nicht die Erkenntnis vielfader Hilflosigkeit den Menschen unserer Tage in die Knie zwingen? Sollte er nicht aufgrund der Erfahrung aller irdischen Hinfälligkeit Gott als den Herrn anerkennen und zur Anbetung Gottes zurückfinden? Ist es nicht so: Die Fortschritte und Errungenschaften des menschlichen Geistes haben unser Selbstbewusstsein in schwindelnde Höhen hinaufgesteigert. Glauben oder glaubten wir nicht, wenigstens bis vor kurzem, die Zukunft der Menschheit mit eigener Kraft steuern zu können? Die in aller Welt zunehmenden Konflikte und Katastrophen müssen uns eines Besseren belehren. Gewiss soll der Mensch sich die Erde untertan machen. Mit einem romantischen Rückzug aus Technik und Naturwissenschaft wäre niemandem gedient. Aber wenn wir weiterhin bei der Einstellung bleiben, dass der Mensch das Maß aller Dinge, dass er sein eigener, absoluter Herr ist, dann wird es fortan immer schneller und immer furchtbarer zum Bruch und zur Zerstörung unserer Welt kommen. Worauf es darum in dieser unserer Situation ankommt, ist die Erkenntnis der wahren Kleinheit und der wahren Größe des Menschen. Der Mensch von heute muss seine Selbstvergötzung aufgeben, er muss den Mut gewinnen, seine Geschöpflichkeit anzuerkennen, sich als Geschöpf zu verstehen, das den Sinn, das Maß und die Kraft seines Daseins nicht sich selbst verdankt, sondern dem Schöpfer. Der Mensch unserer Tage muss zugleich glauben lernen, dass sein Schöpfer ihn liebt, ihn bejaht und ihn mit seiner Macht trägt, der: Mensch muss erkennen, dass die dem Schöpfer gemäße Haltung die der Anbetung ist. Doch: Anbetung Gottes, ist dies heutzutage nicht ein Mauerblümchen bisweilen auch unter Christen? Spricht man nicht da und dort mehr vom Kampf gegen dieses und jenes Übel in der Welt als beispielsweise von der Beleidigung Gottes durch unsere Sünden, als von der Heiligung des einzelnen und unserer Gemeinschaft? Seit geraumer Zeit ist die Rede von einer “anthropologischen” Wende der Kirche, von einer vorrangigen Ausrichtung auf den Menschen. Und viele gestehen tatsächlich der Kirche nur insoweit Existenzberechtigung zu, als sie sich dafür einsetzt, menschenwürdige Verhältnisse in der Welt zu schaffen. So liegt nahe, dass sich für manche das Christsein erschöpft in Mitmenschlichkeit, in caritativer, sozialer und politischer Aktivität. Dem Mitmenschen dienen - so heißt es - ist Gottesdienst, mit ihm sprechen ist Gebet, ihm näherkommen heißt auch Gott nahen. Das ist, recht verstanden, sicher wahr. Der Dienst am Mitmenschen und an der Welt gehören wesentlich zum Christsein. Es ist ein hoffnungsvolles Zeichen, wenn gerade auch junge Christen angesichts himmelschreiender Ungerechtigkeiten in aller Welt die Tat als Zeugnis unseres Christseins fordern, den Dienst des Samariters, der vom Sattel steigt. Doch bei allem Engagement für den Nächsten, gilt es im Auge zu behalten die Quelle und das Ziel der Nächstenliebe: nämlich Gott! Gewiss ist Jesus “der Mensch für die anderen”. Aber das ist nicht alles! Die Mitte Jesu ist Gott! Dem Menschsein Jesu für seine Menschenbrüder und -schwestern geht ein Menschsein für Gott voraus. Und dieses sein Menschsein für Gott ist getragen von Gebet und Gotteslob. Ein russisches Sprichwort mag zum Nachdenken anregen. Es lautet: “Nirgendwo ist mehr Menschlichkeit als dort, wo man Gott anbetet”. Ja, die Hände, die sich zum Herrn wenden, wenden sich auch zum Nächsten hin. Die Knie, die sich vor Gott beugen, beugen sich auch nieder zum Mitmenschen. Das Herz dessen, der den Schöpfer anbetet, schlägt auch für seine Geschöpfe. Edith Stein, die jüdische Konvertitin und Märtyrerin des nationalsozialistischen Regimes, deutet diese Wahrheit an, wenn sie schreibt: “Ich glaube sogar: Je tiefer ein Mensch in Gott hineingezogen wird, desto mehr muss er auch in diesem Sinne ‘aus sich herausgehen’, d.h . in die Weit hinein, um das göttliche Leben in sie hineinzutragen”. Weingarten mit seinem Kloster als Stätte fruchtbaren benediktinischen Wirkens in über 800 Jahren beweist, dass der Christ nicht auf den Knien liegt, und dabei die Welt zugrundegehen lässt, sondern dass der Christ vor Gott auf den Knien liegt, weil er weiß, dass aus dem Gebet wahrhaft Fruchtbares erwachsen kann; weil er weiß, dass Gottesnähe Voraussetzung für Menschennähe ist; weil er weiß, dass der Verlust an Mitmenschlichkeit parallel läuft zum Verlust an Gottverbundenheit; weil er weiß, dass man Gott suchen muss, um den Menschen zu finden. Wir wissen nicht, was kommt: Globaler Umweltvergiftungstod oder Lebenserhaltung, Krieg oder Frieden, Chaos oder eine neue Ordnung. Eines aber wissen wir: Es ist Zeit, vom Schlafe aufzustehen und das Christsein in seinem vollen und echten Sinn zu verwirklichen. St. Benedikt, der geistliche Vater der Weingartener Mönchsgemeinschaft, kann auch uns Heutigen zeigen, was authentisches Christentum ist: “Dem Lobe Gottes darf nichts vorgezogen werden!” “Ora et labora ! “Bete und dann wirke! Betendes Verwurzeltsein in Gott und daraus tatkräftige Mitmenschlichkeit! Das christliche Abendland ist gerade durch diesen Grundsatz des heiligen Benedikt geprägt worden. Aus ihm ist es zu religiöser, geistiger und kultureller Größe gewachsen. Wenn Europa gerettet werden soll, dann nicht zuletzt durch die Rückbesinnung auf diese benediktinische Maxime! Reinhold Schneider berichtet: “Im mittelalterlichen Rußland wurde einem Fürsten, wenn er krank darniederlag, ein heiliges Bild gebracht, damit er durch die Betrachtung des Bildes genese.” Wir sind heute zu einem solchen “heiligen Bild” gepilgert, das uns helfen kann, dass wir selbst und unsere Schwerkranke Welt Genesung finden. Es ist die Reliquie des Blutes Jesu Christi. Wir dürfen uns glücklich schätzen, dass uns diese kostbare Reliquie erhalten blieb. Und da wir davon überzeugt sind, dass uns das Blut Christi Genesung bringt, dass uns durch dieses Blut die Erlösung, die wahre Befreiung geschenkt wurde, verehren wir dieses Blut des Gottessohnes in tiefer Dankbarkeit - hier an dieser geheiligten Stätte, in dieser beeindruckenden Basilika, die zurecht “das Wunder des schwäbischen Barock” genannt wird, aber auch daheim in den Kirchen unserer Gemeinden. Unsere Verehrung des “Heiligen Blutes” soll sich fortsetzen, jedesmal wenn wir die heilige Messe mitfeiern, wo Christi Leib und Blut unter den Gestalten von Brot und Wein gegenwärtig werden. Diese Verehrung soll nach der Eucharistiefeier weitergehen in der Anbetung des im Tabernakel verborgenen Herrn. Dort ist er, der ganze Christus, mit Fleisch und Blut, mit Leib und Seele, Menschheit und Gottheit gegenwärtig - anwesend in einer wirklichen, jedoch unseren Sinnen verborgenen, übernatürlichen Weise. Die Älteren unter uns wissen um die Wandlungen der eucharitischen Frömmigkeit. Als Kinder haben wir Messfeiern vor ausgesetztem Allerheiligsten erlebt, zahlreiche eucharistische Prozessionen und “Sakramentsandachten”. Die “Ewige Anbetung”, das “Vierzigstündige Gebet” waren Höhepunkte im Ablauf des Kirchenjahres. Heute sehen nicht wenige in der Anbetung des allerheiligsten Sakramentes eine mehr oder weniger isolierte Frömmigkeitsübung. Welchen Sinn soll es haben, vor einem Stück “Brot” zu knien und “anzubeten”? Brot ist zum Essen da, nicht zum An-schauen und Andenken! Liebe Mitchristen, in der Geschichte der Frömmigkeit gibt es das Gesetz der Pendelbewegung. Im späten Mittelalter schlug das Pendel stark in die Richtung aus, dass die konsekrierte Hostie in den Mittelpunkt der eucharistischen Verehrung gerückt wurde; die gemeinsame Feier des Opfermahles trat so etwas in den Hintergrund. Heute muss man darauf achten, dass das Pendel nicht in die entgegengesetzte Richtung ausschlägt und die Anbetung des Allerheiligsten zu kurz kommt. Kenner der Kirchengeschichte behaupten, die Eucharistie sei gleichsam der Test für den Glauben der Christen: wenn der Glaube schwach sei, werde die Gegenwart Christi in der Eucharistie bagatellisiert. Doch, wenn es wahr ist, dass Jesus Christus im Tabernakel gegenwärtig ist, mit welchem Recht kann man dann die Anbetung des Allerheiligsten geringschätzen oder “zurückschrauben”? Wenn dies geschähe, wären unsere Kirchen nur noch Museen und unsere Tabernakel nur noch Behältnisse, in denen die übriggebliebenen Hostien aufbewahrt werden. Unsere Kirchen dürfen jedoch nicht Räume sein, die nur der Eucharistiefeier dienen und dann in der übrigen Zeit “funktionslos” bleiben. Und die restlichen Hostien sind eben nicht nur “Mahlreste”.
Unsere ehrfürchtige Haltung vor Gott kann unsere Mitmenschen - denken wir an die vielen, die heute unsere Gotteshäuser kaum noch von Museen zu unterscheiden wissen - daran erinnern, dass es noch etwas Größeres gibt, als all das Sicht-, Hör-, Mess- und Greifbare, dass wir an die Existenz und Gegenwart Gottes glauben. Wo die Ehrfurcht vor Gott verlorengeht, wird es nicht lange dauern, bis auch die Ehrfurcht vor dem Menschen schwindet. Müssen wir nicht alle eine Gewissenserforschung machen, wie es um unsere Ehrfurcht im Gotteshaus und vor allem gegenüber dem Herrn im Tabernakel steht? Hier begegnen wir dem, der in der Eucharistiefeier unter uns gegenwärtig wurde, hier beten wir den an, der uns Weg, Wahrheit und Leben (vgl. Joh 14, 6) ist. Diese Begegnung, die eucharistische Anbetung, ist gleichsam die Fortsetzung der heiligen Messe; diese Begegnung steht im Zeichen des Opfergeschehens der heiligen Messe; sie ist geprägt vom Kreuzestod des Herrn, der sein Blut für uns vergossen hat und der uns in seine Hingabe an den Vater hineinnehmen will. Die eucharistische Anbetung besteht deshalb zutiefst darin, sich mit Jesus zur Opfergabe für den Vater zu machen. Papst Johannes Paul II. erklärte in seinem Schreiben zum Gründonnerstag 1980: Die Verehrung der heiligsten Eucharistie “soll unsere Kirchen auch außerhalb der Messzeiten füllen”. Der Heilige Vater erinnerte an das “persönliche Gebet vor dem Allerheiligsten”; denn: “In diesem Sakrament der Liebe wartet Jesus selbst auf uns. Keine Zeit sei uns dafür zu schade, um ihm dort zu begegnen ... Unsere Anbetung sollte nie aufhören” (“Über das Geheimnis und die Verehrung der heiligsten Eucharistie”, 24. 2. 1980, Nr. 3). Im Tabernakel wartet nicht ein schwacher Mensch auf uns, sondern der allmächtige Sohn Gottes, unser göttlicher Bruder und Freund . Ist es nicht Torheit, ein solches Angebot auszuschlagen ?
Sicher, keiner, dem es mit seinem Glauben ernst ist, will “kalt” am Tabernakel vorübergehen. Für ihn gilt trotz aller bedrängenden Vielfalt an Arbeiten, Aufgaben, Terminen und Verpflichtungen: Liebe macht erfinderisch! Freilich, die Gegenwart des Herrn in der Eucharistie ist ein Prüfstein unseres Glaubens. Jesus Christus in der Hostie schweigt, während das Leben so fordernd und laut ist, so voller Aktivität und Leistung, während die Menschen ihn doch sehr bräuchten, ihn sehen und hören müßten. Ist dieses schweigende Verborgensein des Herrn nicht unserem modernen Lebensgefühl total zuwider, gehen Welt und Eucharistie nicht in entgegengesetzte Richtungen? Man braucht Glauben und Mut, um gegen den Strom der äußeren Dinge vor dem eucharistischen Herrn zu verharren, zu schweigen und anzubeten. Aber wer dies tut, der wird inne: Hier im Tabernakel ist Jesus da als einer, der ganz und gar bei mir ist. Mehr noch, in ihm ist alles, was ich erfahre und erlebe, aufgehoben; denn er hat ein menschliches Herz angenommen und mit diesem die Last aller Zeiten und Menschen. Deshalb kann ich vor dem Tabernakel das ganze Leben einbringen: die Anliegen der Kirche, die vielfältigen Nöte de Welt; alle Menschen, die mich begleitet haben oder noch um mich sind; die Aufgaben, die anstehen sowie die ungelösten Fragen, die unverwirklichten Pläne; mich selbst in aller Armut und Einsamkeit, im Verlangen nach Erfülltsein. Dies alles lege ich zurück in die Hände des Herrn, der auch heute noch einlädt: “Kommet alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt, ich werde euch Ruhe verschaffen” (Mt 11, 28) . Hier im Strahlkreis des eucharistischen Herrn bestärken wir jene Haltung, die den echten Christen ausweist: für Christus leben und aus Liebe zu ihm für die Mitmenschen; denn wenn wir Jesus im Tabernakel als jenen erfahren, der ganz für uns da ist , kann dann unsere Antwort anders lauten, als dass auch wir für den Herrn da sind und mit ihm für die anderen? Das ist der “Weltbezug” der eucharistischen Anbetung, das ist die “soziale” Liebe, zu der sie uns drängt. “Die Eucharistie in ihrem wahren Sinn verstanden, wird von selbst zur Schule tätiger Nächstenliebe” (Johannes Paul II., Schreiben zum Gründonnerstag 1980, “Über das Geheimnis und die Verehrung der heiligsten Eucharistie”, 24. Februar 1980, Nr. 6). Die Eucharistie “in ihrem wahren Sinn verstanden” hat jene Frau, von der ich gleich erzählen will. Sie hat begriffen, es kommt bei der eucharistischen Anbetung weder auf die Länge der Zeit, noch auf erhabene Gedanken und besondere Empfindungen an. All das will und braucht der Herr nicht, er will nur uns selbst, so wie wir sind. Er will unsere Hingabe. Diese Frau berichtet: “Ich bin in die Kirche zum Tabernakel gegangen so wie ich war: mit meiner Einkaufstasche voll Salat, Kartoffeln, Fleisch und Brot. Ich bin zum Herrn gegangen, ganz schlicht in meinem Werktagskleid, mit meinem müden Körper und mit meiner matten Seele, mit einem Herzen voll von Sorge um die Familie, um die Kleinen und um die “Großen”, und um alle, die mir zuweilen ihre Kümmernisse anvertrauen - die Nahen und die Fernen. Ich bin zum Herrn gegangen, im Regen, durch die grauen Straßen, unter dem grauen Himmel, um zu ihm alles Grau zu tragen, das meine Seele und mein Leben füllte ... Er erwartete mich, so wie er alle erwartet, die er gerufen hat - die Frauen und die Männer, die Kinder und die Jugendlichen aller Jahrhunderte. Er erwartete mich ... und ich habe ihm nicht gesagt, was ich ihm sagen wollte: dass das Leben hart ist, dass die Kinder mich ermüden, dass ich es leid bin, alle Tage wieder mit denselben langweiligen Arbeiten anzufangen, mit diesen simplen Dingen, die ich nicht gerne tue und mit denen man niemals fertig wird ... Ich habe nicht gesagt, dass ich manchmal von Flucht träume, von Reisen, von Büchern, von Musik, von Gedichten ... Ich habe ihm nicht meine Ängste, meine Nöte gesagt, dieses ganze Elend der Weit, das schwer auf unseren Herzen und Schultern lastet und vielleicht am schwersten auf den Hausfrauen, deren Männer ohne Arbeit sind ... Ich habe ihm nichts davon gesagt, denn er war ja da und wusste das alles. Ich habe ihm nur “danke” gesagt. Dank, dass er da ist, bei uns armen Menschen dieses späten Jahrhunderts, so wie er da war, damals schlicht unter seinen Landsleuten in Galiläa und Judäa. Dank, dass er niemals überdrüssig wird unserer Schwäche, unserer Sündhaftigkeit, und unserer Auflehnung. Nein, ich habe ihm nicht meine Not gesagt ... Ich habe ihm nur “danke” gesagt. Und ich bin nach Hause gegangen, um meinen Haushalt zu machen, die Suppe zu kochen, die Wäsche zu waschen ... Ich bin nach Hause gegangen durch die grauen Straßen, unter dem grauen Himmel, ... aber es war kein Grau mehr in meiner Seele ...” Meine Zuhörer, stünde es nicht besser auch um unser innerkirchliches Klima, wenn es mehr Christen dieser Art gäbe? Betende, anbetende Christen? “Nicht so viel kritisieren, mehr beten!”, sagte mir vor kurzem eine Allgäuer Bäuerin. Nicht so viel kritisieren, mehr beten und anbeten! Unsere Zeit - ist sie nicht eine Zeit der Kompetenz der Inkompetenten, d.h. je weniger einer versteht, desto lauter schreit er, oder auf gut schwäbisch: je weniger Hirn, desto lauter das Gegacker! - ist voll von bitteren und frustrierten, aggressiven und überkritischen Menschen. Sie greifen alles und alle an, klagen an und kritisieren, sich selbst zumeist ausgenommen. Gewiss bedarf manches in Kirche und Staat einer Erneuerung. Um aber zu einer wirklichen und bleibenden Erneuerung zu kommen, muss man zuallererst beginnen mit der Erneuerung seiner selbst. Muss man herabsteigen von seiner Überheblichkeit, seinem Stolz und seiner Einbildung, von seiner eigen galligen Bitterkeit. Muss man sich hinunterbeugen zur Schlichtheit jener Kleinen, die der Herr seligpreist und die mit ihrem Opfer und Gebet die wahren Erneuerer von Kirche und Welt sind. Muss man in der Anbetung des Allerhöchsten zum rechten Verhalten gegenüber Gott, gegenüber sich selbst und den anderen finden. Wenn die vielen laut- und schreibstarken, lärmenden und aggressiven, bitteren und finsteren Wichtigtuer und Kritikaster einmal längst vergessen sein werden - wahrscheinlich mit einem Seufzer der Erleichterung -, dann wird das Andenken all jener schlichten Beter und Anbeter bewahrt bleiben als ein Segen für uns alle. Denn, so stellt die französische Philosophin Madeleine Debrêl zurecht fest: “Heute ist Beten die größte Wohltat, die man der Weit erweisen kann”. Umkehr in das Gebet, in die Anbetung ist die Notwendigkeit, die notwendende Hilfe in der gegenwärtigen Stunde. Nur die Anbetung Gottes, die radikale Hinwendung zu Gott und die Anerkennung seiner Herrschaft, kann uns davor bewahren, den Götzen unserer Zeit zu verfallen und neuen Zwängen zu erliegen. Die Kirche ist zuerst und vor allem anderen eine betende Kirche - nicht diskutierende, nicht politisierende, sondern betende, anbetende Kirche. Anbetung, Gotteslob, Verherrlichung Gottes ist das Spezifische, das Besondere in und an der Kirche. Wir leisten diese Anbetung stellvertretend und im Namen der gesamten Menschheit. Und wenn es nur wenige wären, die auf Erden noch anbeten; um dieser wenigen willen wäre die Welt nicht verloren und dem Verderben anheimgegeben. In einem alten Buch über das heilige Messopfer steht: “Wenn es keine Messe mehr gäbe, würde die Welt untergehen”. Das klingt übertrieben. Aber ganz so unrichtig ist diese Aussage doch wieder nicht. Solange auf dieser unserer Erde noch gebetet und angebetet wird - und in höchster Weise geschieht dies in der Eucharistie - solange ist die Welt, die Menschheit offen für Gott und damit offen für das Heil. Der Historiker, Philosoph und Dichter Reinhold Schneider schreibt einmal von der Geschichtsmacht des Gebetes und führt dort in etwa aus: Wir wissen nicht, wie die Weltgeschichte verlaufen wäre, wenn mehr gebetet worden wäre. Wir wissen nicht, wie die Weltgeschichte weiterhin verlaufen wird, wenn noch mehr oder noch weniger gebetet würde. Jedenfalls stellen wir mit dem Beten eine Macht dar. Stalin spottete einmal über den Papst und fragte lächelnd: Wieviele Divisionen hat der Papst? Wir können darauf nur sagen: Der Papst hat keine Division mit Panzern, aber viele Divisionen von Betern. Und dann schreibt Reinhold Schneider in einem seiner Gedichte: diesen Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob unseren Häuptern fernzuhalten. Wer von uns wüsste nicht, wie viele und welch schreckliche Schwerter heute über unseren Häuptern schweben und wie nötig darum das Gebet ist? Die Frage an uns, die Frage nach Glück oder Unglück der Menschheit lautet: Entscheiden wir uns in der Dialektik, in der Spannung zwischen Gottzuwendung und Welteinbindung für das, was all unser Wirken für die Weit trägt und fruchtbar macht, entscheiden wir uns für die Anbetung? “Der Tag ist nicht mehr fern, an dem die Menschheit zwischen Selbstmord und Anbetung wählen kann” (Pierre Teilhard de Chardin). Diese unsere Feier, der Blutfreitag, soll uns dazu bewegen, die Anbetung zu wählen. Welchen Stellenwert die Anbetung hat, erfahren wir am besten, wenn wir uns selber hinknien und anbeten. Dann mag uns aufgehen, was ein großer Beter, der in Berlin-Plötzensee von den Nazis hingerichtete Jesuitenpater Alfred Delp, bekannt hat: “Brot ist wichtig, Freiheit ist wichtiger, am wichtigsten ist die ungebrochene Treue und die unverratene Anbetung.” Amen.
|
|||
 Umkehr in die Anbetung
Umkehr in die Anbetung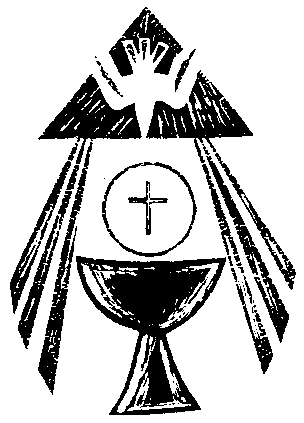 Nein, in den Tabernakeln unserer Kirchen ist Christus wirklich anwesend. Hier können wir
ihm wahrhaft begegnen. Und diese Tatsache sollte auch die Art und Weise bestimmen, wie wir uns im Gotteshaus benehmen. Wer je einen Gottesdienst im Ritus der Ostkirche
miterlebt hat, der war sicher beeindruckt von der tiefen Ehrfurcht der orthodoxen Gläubigen vor dem Heiligen. Unwillkürlich drängt sich da die Frage auf, ob wir, die
Christen im Westen, nicht dabei sind, etwas überaus Kostbares zu verlieren - etwas Kostbares, das für unser religiöses Leben von unschätzbarer Bedeutung ist? Es ist die
Ehrfurcht vor Gott. Sie muss besonders im Gotteshaus zum Ausdruck kommen. Es handelt sich dabei nicht um Äußerlichkeiten, sondern um einen sinnvollen Ausdruck dafür, dass
sich der Beter mit Geist, Leib und allen Sinnen der Gegenwart des heiligen Gottes bewusst ist. Geht bei uns nicht mancher zum Gottesdienst, auch zur heiligen Kommunion” und
dann wieder aus der Kirche heraus, ohne eine einzige Kniebeuge gemacht, ohne je die Hände gefaltet zu haben?
Nein, in den Tabernakeln unserer Kirchen ist Christus wirklich anwesend. Hier können wir
ihm wahrhaft begegnen. Und diese Tatsache sollte auch die Art und Weise bestimmen, wie wir uns im Gotteshaus benehmen. Wer je einen Gottesdienst im Ritus der Ostkirche
miterlebt hat, der war sicher beeindruckt von der tiefen Ehrfurcht der orthodoxen Gläubigen vor dem Heiligen. Unwillkürlich drängt sich da die Frage auf, ob wir, die
Christen im Westen, nicht dabei sind, etwas überaus Kostbares zu verlieren - etwas Kostbares, das für unser religiöses Leben von unschätzbarer Bedeutung ist? Es ist die
Ehrfurcht vor Gott. Sie muss besonders im Gotteshaus zum Ausdruck kommen. Es handelt sich dabei nicht um Äußerlichkeiten, sondern um einen sinnvollen Ausdruck dafür, dass
sich der Beter mit Geist, Leib und allen Sinnen der Gegenwart des heiligen Gottes bewusst ist. Geht bei uns nicht mancher zum Gottesdienst, auch zur heiligen Kommunion” und
dann wieder aus der Kirche heraus, ohne eine einzige Kniebeuge gemacht, ohne je die Hände gefaltet zu haben?